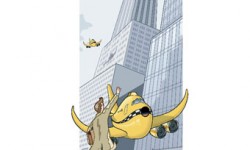Der Himmel wird neu erobert
Je nachdem, wem man Glauben schenken darf, geht der Trend in der zivilen Luftfahrt entweder in Richtung „Super-Jumbo“ mit enormen Beförderungskapazitäten oder in Richtung kleine, effiziente Jets und „Mikrojets“, die auch regionale Flugplätze anfliegen können.
Es wird mehr geflogen als je zuvor. Die Folge ist ein zunehmendes Gedränge in den Lufträumen und auf den Flugplätzen.
Indien und China verzeichnen nie dagewesene Wachstumsraten im Flugverkehr, und dieser Trend wird aller Voraussicht nach anhalten. Bis 2024 soll die zivile Luftfahrt in China um jährlich 8,8 Prozent zulegen (Peking ist Gastgeber der Olympischen Spiele 2008 und in Shanghai findet 2010 die Weltausstellung statt). Für Indien liegt die Zuwachsrate bis 2010 bei jährlich 25 Prozent. Solche Zahlen machen Asien für Fluggesellschaften besonders attraktiv.
Allerdings machen die horrenden Ölpreise einen Großteil der Gewinne zunichte. Einige Airlines haben bereits Konkurs anmelden müssen. Vor allem nordamerikanische Luftfahrtunternehmen sind in der Gefahrenzone. Nach Angaben der IATA (International Air Transport Association) verzeichnete die Luftfahrtindustrie 2005 durch den Ölpreisanstieg weltweit Verluste in Höhe von sechs Milliarden Dollar (rund fünf Milliarden Euro), obgleich die Passagierbeförderung global um 8,7 Prozent gestiegen ist.
Hinzu kommt noch der ökologische Aspekt. Flugzeuge zählen zu den größten Umweltverschmutzern unter den Transportmitteln. Die 16.000 Verkehrsflugzeuge, die weltweit registriert sind, produzieren jährlich über 600 Millionen Tonnen Kohlendioxid, wie in einem Bericht in der Zeitschrift National Geographic zu lesen ist.
Gleichzeitig schießen überall auf der Welt Billig-Airlines buchstäblich wie Pilze aus dem Boden – in Asien, in Europa, in Nord- und in Südamerika. Mit ihrem abgespeckten Service und „No-Frills“-Konzept, das heißt keine kostenlose Verpflegung und keine Extras, bedrohen sie die Existenz der traditionellen Fluggesellschaften.
Diese und andere Trends zwingen Flugzeughersteller wie Boeing in den USA, Airbus in Europa, Bombardier in Kanada und Embraer in Brasilien dazu, die Frage, welche Flugzeuge gebaut werden sollen, neu zu überdenken.
Man ist sich jedoch keineswegs einig über die Situation. Die Zukunft der zivilen Luftfahrt wird von den Flugzeugherstellern unterschiedlich beurteilt.
Airbus und Boeing sind weltweit die beiden größten Hersteller von Verkehrsflugzeugen. Zusammen verkauften sie 2005 die enorme Zahl von 2.057 Maschinen, ein Rekordabsatz, der 2006 um die Hälfte geringer ausfallen dürfte, wie der International Herald Tribune zu berichten weiß. Über 40 Prozent der Bestellungen kamen von asiatischen Fluggesellschaften.
Airbus gab Anfang 2005 seine Pläne zum Bau des größten Passagierflugzeugs der Welt, des A380 mit einer Beförderungskapazität von 800 Passagieren in drei verschiedenen Klassen, bekannt. Mit dieser Mammutmaschine will man die Boeing 747 als größtes und meist verkauftes Flugzeug entthronen. Die Boeing 747 hat Platz für 420 Passagiere.
Airbus schreibt größeren Flugzeugen ökologische Vorteile zu. Nach Aussage des Unternehmens wird der neue ‘Super-Jumbo’ nicht nur zu einer Entlastung der am stärksten frequentierten Flugstrecken beitragen, indem mehr Passagiere befördert werden, sondern auch zu einer Reduzierung des Schadstoffausstoßes, da die pro Passagier verbrauchte Treibstoffmenge die Maschine zu einem umweltfreundlicheren Transportmittel macht als die meisten Personenkraftwagen. Auch die Betriebskosten pro Sitzplatz sollen beim A380 um 15 bis 20 Prozent niedriger sein als bei der B747. Einer Untersuchung der BBC zufolge liegt die Treibstoffeffizienz bei 31,8 Kilometer pro Liter und Passagier.
Während sich Airbus auf große Flugzeuge konzentriert, ist Boeing der Ansicht, dass Großraummodelle mit gewaltigen Beförderungskapazitäten, die überlastete Knotenpunkte des internationalen Luftverkehrs anfliegen, der Vergangenheit angehören. Das in Chicago ansässige Unternehmen setzt stattdessen auf seine neue B787, die 2008 in Dienst gestellt werden soll. Die mittelgroße Maschine hat die Reichweite eines Großjets.
Der Dreamliner, wie die B787 genannt wird, trägt den Bedürfnissen der Passagiere nach Geschwindigkeit und Direktanschlüssen Rechnung, behauptet Boeing. Die B787 wird 300 Passagiere befördern können und eine Reichweite von 16.000 Kilometern haben. Nach Angaben auf Boeings Website soll das schnelle und treibstoffeffiziente Flugzeug 20 Prozent weniger Kerosin verbrauchen als andere Modelle vergleichbarer Größe. Ein weiteres Plus ist, dass regionale Flugplätze ohne Probleme angeflogen werden können. Im Gegensatz dazu müssen für den A380 viele Flughäfen umgebaut werden.
Auf der asiatischen Luftfahrtmesse Asean Aerospace, die im Februar 2006 stattfand, konnte Boeing 354 Bestellungen für die neue B787 entgegennehmen – doppelt so viele wie Airbus.
Obwohl Airbus und Boeing Erzrivalen sind, könnte man von ihren beiden neuesten Modellen behaupten, dass sie einander ergänzen. Der ‘Super-Jumbo’ A380 ist für so viel beflogene Strecken wie Paris/New York geeignet, während die B787 eher für Langstreckenflüge mit weniger Passagieren passt.
Neben größeren, schnelleren und umweltverträglicheren Flugzeugen setzt die Luftfahrtindustrie auch auf kleinere und flexiblere Maschinen.
Der amerikanischen Bundesluftfahrtbehörde (FAA) zufolge kommt der Markt für „Mikrojets“ allmählich in Gang. Ein Mikrojet ist ein kleines Passagierflugzeug mit einer Beförderungskapazität von acht bis zehn Passagieren, das kleine, oft stadtnahe Flughäfen anfliegt. Die als „Lufttaxis“ bezeichneten Maschinen erreichen etwa zwei Drittel der Fluggeschwindigkeit von gewöhnlichen Verkehrsjets, und sind deutlich preiswerter.
Wie die FAA mitteilte, sollen 2006 Hundert Mikrojets ihren Flugbetrieb aufnehmen. Bis 2010 sollen sich über 1.500 solcher Modelle im amerikanischen Luftraum bewegen.
Zu den Unternehmen, die sich an diesem wachsenden Markt der Lufttaxis unbedingt beteiligen wollen, gehören Cessna, Eclipse Aviation, Adam Aircraft und Cirrus Design. Sogar Embraer, der brasilianische Hersteller der beliebten 110-sitzigen City Hoppers für Kurzstreckenflüge, kündigte im November 2005 die Einführung eines eigenen Mikrojet-Modells mit der Bezeichnung Phenom 100 an.
„Wir befinden uns an der Schwelle zu einem neuen Geschäftskonzept“, sagte Nan Shellabarger von der FAA im März 2006 gegenüber der New York Times.
„Die Amerikaner warten auf ein umfassendes Lufttaxisystem“ schrieb Rich Karlgaard in der Zeitschrift Forbes. „Lasst sie nicht länger warten.“